READER: OTTETTO
29.07.2025

Riccardo Nova: Ottetto (2012) – 19′
für vier Saxofone, vier Schlagzeuger:innen und Elektronik / for four saxophones, four percussionists and electronics
Teilnehmer:innen des / Participants of the Percussion Studio
Jeong Hyun Hwang
Keith Ng
Aditya Bhat
Jieru Ma
Teilnehmer:innen des / Participants of the Saxophone Studio
Kyle Hutchins (Sopransaxofon)
Robert Burton (Altsaxofon)
Paula Soriano Ibáñez (Tenorsaxofon)
María Luisa Cuenca Arraez (Baritonsaxofon)
Håkon Stene (Musikalische Leitung, Percussion Studio)
Jennifer Torrence (Percussion Studio)
Patrick Stadler (Saxophon Studio)

OTTETTO
Ottetto ist eine Meditation über das Ein- und Ausatmen (Pranam), ein langsames Oszillieren zwischen zwei Zuständen, eine hypnotisch wiederkehrende Bewegung, die sich beschleunigen, verlangsamen oder konstant bleiben kann. Zyklisch taucht eine mehr oder weniger offensichtliche Veränderung auf, eine neue Richtung, eine Frage, gefolgt von einer Antwort, wenn möglich, oder einfach eine zweite Frage. Ich habe eine komplexe metrische Struktur verwendet, eine Art unsichtbaren ‚dēmiurgòs‘, eine unerbittliche ordnende Kraft. In der vedischen Tradition galt ein (poetisches) Metrum als kostbare Gabe, als Werkzeug, das zur Erreichung eines Ziels eingesetzt werden konnte, oder sogar als Waffe der Zerstörung.
Dieses Stück wurde im Auftrag von BL!NDMAN in Auftrag gegeben und ist BL!NDMAN gewidmet.
Riccardo Nova
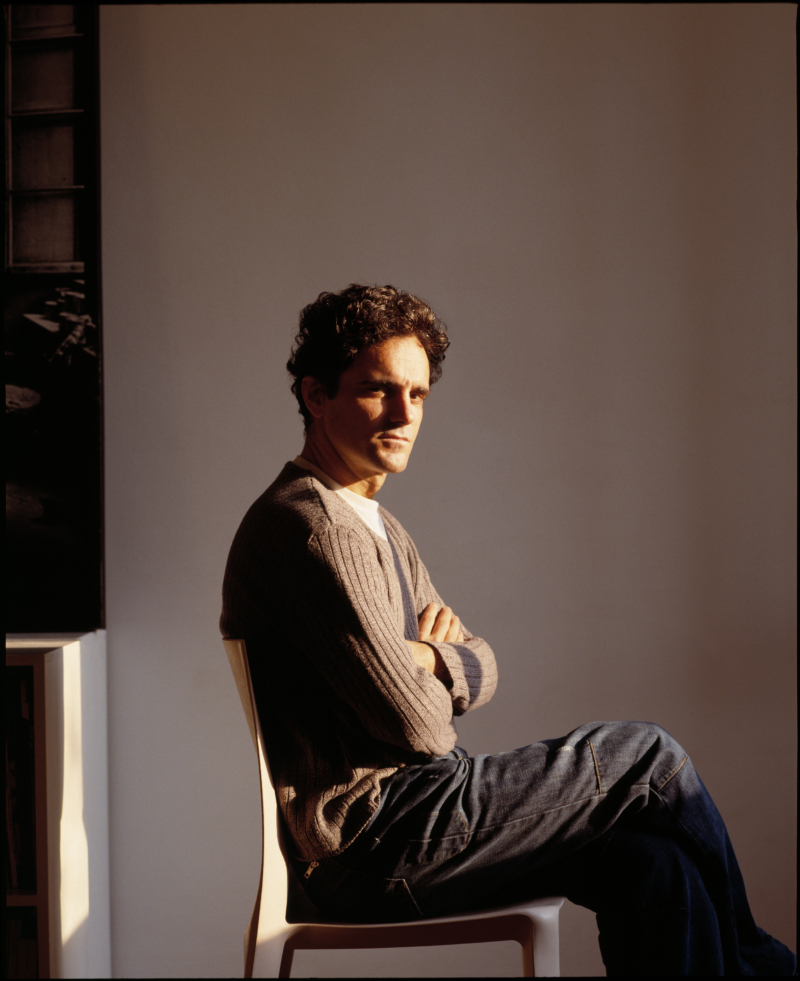
KL: Das Werk, das wir morgen hören werden, ist Ottetto für zwei Quartette. Sie haben mir erzählt, dass Sie zur Zeit der Komposition in Indien waren. Wo haben Sie sich in Indien aufgehalten und wie hat sich das in diesem Stück niedergeschlagen?
Ich habe tatsächlich acht Jahre lang in Südindien gelebt. Als ich Anfang der 90er Jahre mein Konservatorium und die akademischen Studien in Italien beendet hatte, ging ich nach Indien. Ich interessierte mich für die südindische Musik wegen des rhythmischen Aspekts der Musik. Also ging ich jedes Jahr für drei oder vier Monate dorthin und lebte bei einer Musikerfamilie. Nachdem ich mehrere Jahre lang Mridangams, ein südindisches Schlaginstrument, gelernt hatte, begann ich mit indischen Musiker:innen und Ensembles zu arbeiten. Also beschloss ich, dort zu leben, um weiter indische Musik zu studieren. Ottetto war in dieser Zeit, in der ich mein Haus in Mysore in Südindien hatte. Das ist in Karnataka, in der Nähe von Bangalore.
KL: Was können wir von Ottetto erwarten und was sind einige Dinge, die Sie damit verbinden?
Es ist ein älteres Stück, von 2012, und es ist in einem rhythmischen Zyklus aufgebaut, der sich vom Anfang bis zum Ende wiederholt. Was auch immer passiert, ist also mit diesem zeitlichen Zyklus verbunden. Es gibt einige hierarchische Punkte in diesem
rhythmischen Zyklus, an denen man stärkere Akzente hört. Alles hängt also mit diesem Zyklus zusammen, der in der indischen Musik „Tala“ genannt wird, was „Takt“ oder eben „Zyklus“ bedeutet. Es ist eine Zeitspanne, die sich wiederholt. In diesem Stück ist es ein 19-hebiger Zyklus, der sich von Anfang bis Ende in verschiedenen BPM wiederholt.
Alle Obertöne, die Akkorde und alles andere sind in reiner Intonation. Ich habe viel mit den Obertönen der Saxophone gearbeitet und viele Voraufnahmen des Materials mit Obertönen gemacht, sie bearbeitet und zusammengefügt. Die Elektronik besteht
also im Wesentlichen aus natürlichen Obertönen verschiedener Saxophongrundtöne.
KL: Was hat Sie überhaupt an dieser Besetzung eines Saxophonquartetts interessiert?
Es ist interessant, weil es ein monochromes Ensemble ist. Was das harmonische Spektrum und solche Dinge angeht, funktioniert es sehr gut, weil der Klang zur gleichen Familie von Timbres gehört. Ich war auf der Suche nach den Spektralklängen, und
das war faszinierend. Außerdem kann gerade das Bariton-Saxophon eine Menge Obertöne erzeugen. Ich glaube, ich habe es bis zur 17. Harmonischen benutzt, es gibt viele natürliche harmonische Möglichkeiten auf verschiedenen Grundtönen. Ich
habe im Quartett viel mit diesen Obertonspektren experimentiert.
KL: Und der Perkussionspart? Welche Rolle hat er in dieser Klangwelt?
Der Perkussionspart spielt eher die untermalende rhythmische Rolle. Normalerweise versuche ich, die harmonischen Aspekte der Musik in horizontale rhythmische Muster umzusetzen. Denn der Rhythmus ist eine Art langsames Intervall. Wenn ich an das
Verhältnis 2:3 denke, fällt mir sofort das Intervall einer Quinte ein, ein Tritonus ist 5:7, und so weiter. Ich versuche sofort, alle harmonischen Aspekte in rhythmische Aspekte umzuwandeln, also ist die rhythmische Struktur eigentlich eine Art Umwandlung der vertikalen Aspekte. Ich versuche immer mehr das zu tun, und dieses Stück stand wirklich am Anfang dieser Forschung.
KL: Sie haben in einigen Texten über das Stück erwähnt, dass diese rhythmische Dimension – die in der indischen Musik im Allgemeinen sehr wichtig ist – für Sie eine besondere Bedeutung hat, weil Metrum und Rhythmus auch im vedischen Hintergrund
von besonderer Bedeutung sind.
Ja, ich habe mich schon immer sehr für die rhythmischen Aspekte interessiert. Ich erinnere mich, dass ich als 10-Jähriger in der Grundschule ein Konzert besuchte, in dem ein Tabla-Spieler und ein indischer Musiker auftraten – ich war schockiert von
der rhythmischen Virtuosität dieser Musik! Als ich begann, mich intensiver mit indischer Musik zu beschäftigen, auch durch das Studium von Messiaen, war es für mich nach dem Konservatorium ganz natürlich, nach Indien zu gehen. Ich begann, einige Jahre lang südindische Musik zu praktizieren, und da ich in einer Familie von Brahmanen lebte, rezitierten wir die ganze Zeit die Veden. Mir fiel auch auf, dass die Veden rhythmisch sehr interessant sind. Alles ist metrisch, es gibt sehr strenge Regeln, um sie zu rezitieren, und es gibt Mnemotechniken, um Permutationen dieses Gesangs zu bilden. Es ist wirklich mit dem Kontrapunkt des Mittelalters verwandt, nicht in der harmonischen Dimension, sondern in der zeitlichen Dimension. Es ist wirklich eine Kombinatorik, ein System, das dem ähnelt, was in der westlichen Musik in der vertikalen Dimension passiert.
Ich war an dieser mnemotechnischen Technik interessiert. Eigentlich ist die indische Musik eine rein mündliche Tradition, die auf die Entwicklung eines starken Gedächtnisses ausgerichtet ist. Sie benutzen nicht die Augen, weil sie keine Noten lesen. Sie benutzen nur das Ohr und haben diese Mnemotechniken. Es handelt sich also um eine Art komplementäres Universum zur westlichen Musik, bei der die Augen ein sehr wichtiges Werkzeug sind. Wir fangen an, Musik durch Lesen zu lernen, und selbst wenn wir Musik auswendig lernen, benutzen wir eine Art visuelles Auswendiglernen. Das gibt es in der indischen Musik nicht, alles basiert auf dem Gehör und dem Gedächtnis. Und die Metrik hilft dem Gedächtnis sehr. In der westlichen Musik gibt es die Metrik nicht mehr, weil wir sie nicht mehr brauchen. Wir schreiben alles auf, wir transkribieren alles und es ist wie eine Festplatte. Es ist außerhalb unseres Geistes.
KL: Es geht um mündliche und schriftliche Überlieferung. Vor allem in späteren Werken haben Sie versucht, diese beiden Traditionen zu verbinden. An Ihrem Opernprojekt Mahābhārata, nach dem gleichnamigen großen antiken Epos, das zum Teil mit dem Ensemble Musikfabrik realisiert wurde, sind auch karnatische Musiker beteiligt. Für sie ist eine geschriebene Partitur also wahrscheinlich eine ziemliche Herausforderung.
Es ist eine ziemliche Herausforderung und ein langer Prozess. Die südindischen Musiker:innen, die an der Musikfabrik beteiligt waren, kenne ich seit vielen Jahren – die Sängerin habe ich zum ersten Mal getroffen, als sie drei Jahre alt war, und den Perkussionisten, als er ein Teenager war. Es war also ein langer Prozess, und jetzt benutzen sie auch die Augen, weil sie eine Schreibtechnik entwickelt haben, eigentlich ihre eigene Notation. Ich habe viel Zeit damit verbracht, ihnen die ganze Musik zu diktieren, damit sie sie in ihre Notation übertragen konnten. Aber sie benutzen die Schrift, um sich an etwas zu erinnern, das sie bereits kennen. Sie sehen es, dann rufen sie es ab, das Muskelgedächtnis kommt sofort zurück. Es ist eine andere Art, Musik zu lesen.
KL: Und im Fall von Ottetto war es wahrscheinlich umgekehrt – Sie haben mit zwei Quartetten des BL!NDMAN-Ensembles zusammengearbeitet.
Ja, das ist ein großes Ensemble mit Sitz in Belgien.
KL: Als Sie ihnen die Partitur präsentierten, die von diesen indischen Rhythmen beeinflusst war, welchen Lernprozess mussten sie durchlaufen, um sich zum Beispiel an die 19-Takt-Rhythmen zu gewöhnen?
Es sind nicht wirklich traditionelle indische Rhythmen, aber sie sind mit dieser zyklischen Sichtweise der südindischen Musik verbunden. In der südindischen Musik gibt es verschiedene Formen, wie z.B. das, was sie „den Kuhschwanz“ nennen, der von groß nach klein geht oder umgekehrt von von klein nach groß. Es gibt mehrere Formen, die ich in diesem Stück verwendet habe. Es gibt zum Beispiel einen Abschnitt, der von 19 Schlägen auf einen Schlag geht, also eine Art rhythmische Beschleunigung. Es ist nicht leicht, das zu lernen. Es ist sogar einfacher, wenn man die Noten nicht liest, denn wenn man alles in seinem Muskelgedächtnis hat, wird es ganz natürlich.
Auch bei der Erfahrung mit dem Ensemble Musikfabrik sagten sie anfangs: „Nein, das geht nicht.“ Aber nach dem Üben und weil sie das Beispiel der indischen Musiker:innen hatten, die es einfach konnten, wurde es auch für die Musiker der Musikfabrik ganz
natürlich.
KL: Sind diese Zahlenbeziehungen auch mit einer symbolischen Bedeutung verbunden, z.B. durch vedische Hintergründe?
Zahlen sind in der vedischen Tradition sehr wichtig. Jedes Metrum ist mit einem Gott verbunden. Rudra zum Beispiel hat ein 11-hebiges Metrum, das mit ihm verbunden ist. Außerdem gibt es sehr wichtige Mantras, die nur eine Art Zahlenfolge sind. Es gibt ein sehr wichtiges in der letzten Sammlung des Rudra-Mantras, das nur eine Reihe von ungeraden Zahlen bis 33 ist, dann nur noch Vielfache von 4 und so weiter. Es gibt diese seltsamen Zahlenfolgen, und ich habe sie benutzt, um in dem Opernstück mit dem Ensemble Musikfabrik Harmonien zu schaffen. Aber Zahlen sind auch in der indischen Musik im Allgemeinen sehr wichtig, weil man mit den Musiker:innen durch Zahlen kommuniziert. Ganz am Anfang lernen sie zu zählen – jede Art von Zahl, gerade und ungerade Zahlen mit einer Folge von Silben.
KL: Sehen Sie Ihre Musik als eine Art andere Form dieser religiösen und kulturellen Aspekte, die Sie in Indien kennengelernt haben?
Nicht genau, aber es ist natürlich eine Verbindung zwischen diesen beiden Traditionen, der schriftlichen Tradition der westlichen Musik mit all den Möglichkeiten, die sie einem bietet: Wenn man etwas aufschreibt, hat man enorme Möglichkeiten der Harmonik und Orchestrierung, man kann mit vielen Instrumenten arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es die mündliche Tradition, die enorme mnemotechnische und kombinatorische Techniken entwickelt hat, weil sie im Grunde eine solistische Musik ist. Sie hatten die Freiheit, die rhythmischen Aspekte viel stärker zu entwickeln als in der westlichen Musik, weil sie nicht an die Vertikalität der Musik gebunden sind.
Die vedische Tradition beschäftigt sich so sehr mit rhythmischen Aspekten, weil Sanskrit immer noch eine Sprache ist, die eine quantitative Metrik beibehalten hat – lange und kurze Silben. Wenn man also Sanskrit spricht oder rezitiert, ist es bereits eine rhythmische Sprache, denn man muss sich bewusst sein, dass es Silben gibt, die einen Wert von drei Schlägen haben, andere mit einem Wert von zwei Schlägen und wieder andere mit einem Schlag. Wenn man also genau rezitieren will, muss man wie ein:e Musiker:in zählen und jede Rezitation ist Musik und eigentlich ein Ritual.
KL: Wollen Sie diese rituelle Qualität in Ihren schriftlichen Werken beibehalten?
Heutzutage ist alles, was ich mache, mit dem Mahābhārata-Opernprojekt verbunden, das eine Oper in drei Akten sein wird. Selbst wenn ich also ein kleines Stück schreibe, wird es eine Studie sein, die damit zusammenhängt. Ich beschäftige mich intensiv mit den vedischen Mantras und dem Sanskrit-Text des Mahābhārata. Ich arbeite also viel mit Vokalmusik, und die Sanskrit-Metrik leitet mich dabei. Sie enthält bereits ein sehr strenges metrisches Muster, und ich folge ihm. Ich versuche, mein Ego in diesen
Texten zu verlieren, um sie zum Sprechen zu bringen. Ich versuche nicht, mich selbst auszudrücken, sondern die Musik aus den Mantras und Texten selbst entstehen zu lassen.
Fragen: Karl Ludwig
